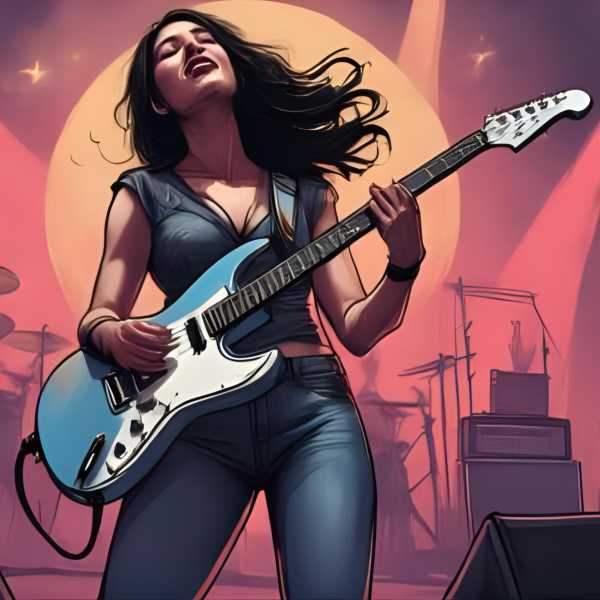Eine georgische Tafel hätte das Paradies bedeutet
Diese Geschichte stammt aus dem Jahr 2009. Hier schildere ich die Recherche nach den Spuren von Kriegsgefangenen aus dem II. Weltkrieg in Georgien. Diese Recherchen und die Familiengeschichte meiner Frau bilden die Basis für den Roman Georgische Wurzeln.
Auf der Suche nach einer Geschichte in Georgien
Die Straße nach Sairme windet sich den Berg hinauf. Rechts neben mir gähnt ein Abgrund, unten schimmert silbern ein Bach durch die grünen Bäume. Wir fahren im September 2009 ein Tal im Süden von Georgien hoch. Ich bin auf der Suche nach mehreren Geschichten.
Die Geschichte des Romans, an dem mein Kopf gerade arbeitet, dreht sich um Jan. Er ist etwa 30 Jahre alt. Er hat in Georgien gerade den Mann gefunden, der nach dem II. Weltkrieg als Offizier der Roten Armee Vater seiner Mutter geworden war. Der deshalb auf Order von Stalin Deutschland verlassen musste. Dieser Mann fährt mit ihm 50 Jahre danach hoch nach Sairme. Soweit die Fiktion.
Unser Ziel kenne ich bereits. Es ist Sairme, ein Kurort mit guter Luft und gutem Heilwasser, idyllisch in den Bergen des südlichen Georgien gelegen. In der Zeit der Sowjetunion brachten bevorzugte Mitglieder der Partei hier ihre Gesundheit in Ordnung.
Diese Straße wurde von deutschen Kriegsgefangene gebaut. Einige von ihnen liegen auf einem Friedhof.
Die Kriegsgefangenen und ihr Werken in der Sowjetunion
Nach dem II. Weltkrieg gab es 3,06 Millionen deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, von denen 1,09 Millionen starben. Rund 1,4 Millionen Gefangene wurden zur Arbeit in den Bergwerken, zum Bau von Straßen, Brücken, Bahnlinien, Kraftwerken und Siedlungen eingesetzt. Viele starben an Hunger, Kälte, Überarbeitung oder durch Misshandlungen und Strafmaßnahmen der Bewacher. In der gesamten Sowjetunion gab es 2.454 Lager.
In Georgien waren es 61 Lager, in die rund 40.000 Kriegsgefangene gebracht wurden. In Tbilisi bauten sie Brücken. Auch die Brücke über den Enguri an der Grenze zur abtrünnigen Teilrepublik Abchasien, seit dem Krieg im August 2008 russisch besetzt, wurde von deutschen Kriegsgefangenen gebaut. In der Nähe des Kurortes Borjomi, in der Zeit der Sowjetunion berühmt für sein Mineralwasser, bauten die Gefangenen ein Wasserkraftwerk. Und sie bauten diese Straße hoch nach Sairme.
Im Lager hier waren mehr als 100 Kriegsgefangene stationiert. Wie viele es genau waren, ließ sich auch nach längerer Recherche und Befragung von Zeitzeugen nicht mehr feststellen. Rund 100 von ihnen verließen am Ende den Ort, berichtete eine Zeugin. Etwa 50 von ihnen sind hier begraben.
Ein richtiges Grab
Seit dem Ende der Sowjetunion haben Organisationen wie der deutsche Volksbund für Kriegsgräberfürsorge oder die russische Organisation Memorial dafür gesorgt, dass Opfer des II. Weltkriegs ein Grab bekamen. Bekannt sind dabei die Bemühungen, die sterblichen Überreste der Toten der Kampfhandlungen in Stalingrad aus der Erde zu bergen, sie zu identifizieren und ihnen ein Grab zu geben.
Auch die Toten unter den Kriegsgefangenen haben in diesen Jahren ein richtiges Grab bekommen. Es gibt mehrere Hundert Friedhöfe in den Staaten der früheren Sowjetunion, allein in Russland sind es 813. In Georgien sind 41 Friedhöfe, auf einem der größten in Tbilisi wurden knapp 4.000 Kriegsgefangene bestattet.
Wir selber waren an der georgischen Heerstraße, die von Tbilisi nach Norden nach Russland führt. Dort gibt es einen Friedhof in 2.400 Metern Höhe auf dem Kreuz-Pass, auf dem rund 200 Kriegsgefangene bestattet sind. Zwei Friedhöfe bei Tschiachewi in der Nähe von Borjomi liegen etwas abseits der Straße. Die dort bestatteten knapp 200 Gefangenen bauten an dem Wasserkraftwerk.
Der Friedhof in Sairme: 7 Jahre Zahn der Zeit
Im Jahr 2002 war ich das erste Mal in Sairme. Wir sind über eine Erdstraße den Berg hoch geschlichen. Der Friedhof für die deutschen Kriegsgefangenen liegt am Eingang des Ortes. Er ist als Treppe den Hang hinauf angelegt. Für jeden Toten wurde eine kleine Steinsäule aufgestellt. In der Mitte des Friedhofs stand ein gespaltenes Kreuz.
Nun, im September 2009, hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Die Straße ist mittlerweile asphaltiert. Die Stufen der Treppe hoch zu den Gräbern sind angebrochen. Aus dem gespaltenen Kreuz ist ein Stück heraus gebrochen, das an die Mauer den Hang hinein gelehnt ist. Mehrere Steinsäulen sind zerstört. Auf den Gräbern selber ist Gras gewachsen.
Kein Schlaf auf den Knochen der Kriegsgefangenen
Um diese Kriegsgefangenen ging es in einem Artikel, den ich 2006 in der Kaukasischen Post gelesen hatte. Die Kriegsgefangenen sollten neben der Straße verscharrt worden sein. An dieser Stelle sei dann ein Pensionat errichtet worden. Die Gäste im Erdgeschoss hatten schlaflose Nächte. 1994 kam man dann auf die Idee, das Pensionat abzureißen. Im Fundament habe man dann tatsächlich die Schädel und Knochen der Kriegsgefangenen gefunden, auf denen das Pensionat gebaut worden war. Sie bekamen dann ihren eigenen Friedhof. Und nicht nur die Nächte seien dann mit Schlaf gefüllt gewesen, es habe auch keinen tödlichen Unfall mehr auf der Straße gegeben.
Aber stimmte die Geschichte auch wirklich?
Offiziere waren sehr streng
Eine ältere Frau in Bagdati, unten im Tal, hatte zwar nicht selbst miterlebt, wie die deutschen Kriegsgefangenen in Georgien waren. Sie hat aber den Geschichten der Älteren über den Bau dieser Straße gelauscht.
Das Gefangenenlager in Sairme war dort, wo alte Hütten standen, berichtete die Frau. In Sairme hätten seinerzeit nur sehr wenige Familien gewohnt. Sie durften keinen Kontakt zu den Gefangenen haben, aber die Bewohner versuchten dies trotzdem. Es war nicht einfach für sie, aber sie seien trotz des Krieges sehr menschenfreundlich gewesen. Was man über die Offiziere oder die Vorarbeiter dort nicht sagen konnte, denn diese seien sehr streng gewesen.
Unsere Zeitzeugin erzählte uns die Geschichte eines Nachbarjungen. Dieser habe einen Gefangenen ins Auge gefasst und für ihn habe er zu Hause Essen gestohlen, um es diesem Gefangenen zu geben. Er habe es immer auf einen bestimmten Platz gelegt, von wo es dieser Gefangene dann nehmen konnte. Der Vater habe davon erfahren und dem Kind dies verboten, weil er Angst bekommen habe. Dann habe der Junge angefangen zu weinen und die Mutter habe ihm das Essen gegeben. So habe der Junge diesem Gefangenen das Leben gerettet.
Sie berichtete, dass die Gefangenen manchmal die Buchen geschüttelt haben, wenn sie Hunger hatten. Dann hätten sie von dem Buchweizen gegessen, um den Hunger zu stillen.
Eine georgische Tafel
Wer einmal zu Besuch in Georgien ist, der wird sicherlich zu einer georgischen Tafel eingeladen. Neben dem Ritus der Wahl eines Tischführers (Tamada), der Trinksprüche vorgibt und zu Trinkrunden einlädt, gibt es traditionelle georgische Gerichte. Auf dem Tisch stehen dann Hähnchen in Nusssauce, gekochtes Rindfleisch, über Holzfeuer geröstetes Schweinefleisch mit frischen Zwiebeln, Bohnen, das traditionelle georgische Chatschapuri, Käse aus eigener Produktion, Maisbrot, frische Gurken und Tomaten.
Den Deutschen, die rund 60 Jahre zuvor hier waren, ging es anders. Für sie hätte eine solche Tafel das Paradies bedeutet. Sie mussten hart arbeiten, bekamen aber nur wenig zu Essen. Zwei Liter Suppe und ein Laib Brot, dazu etwas Fisch, konnten kaum die Kalorien ersetzen, die sie bei der Arbeit verbrauchten. Viele starben des Hungers oder an den Folgen der Unterernährung und der Entkräftung.
An der Quelle
Wenn man die Straße den Berg herunter fährt, taucht auf der Bergseite eine Quelle auf, aus der kühles Wasser fließt. Neben der Quelle hat jemand ein Gesicht in Stein gehauen. Gegenüber auf der Talseite hat ein älterer Mann einen Stand aufgebaut, auf dem er Honig und daraus selbst gebrannten Schnaps anbietet. Ich trinke ein Gläschen. Der Mann ist 1934 geboren, im gleichen Jahr wie mein Vater. Das Gesicht in Stein gehört zu mehreren Kunstwerken, die er hier geschaffen hat. Er fragt, woher ich komme. Ich sage ihm, was wir hier suchen. Und dann fängt er an zu erzählen.
Als Kind habe er die deutschen Kriegsgefangenen gesehen, wie sie zum Arbeitseinsatz gelaufen sind. Arme Gestalten, mit denen man Mitleid gehabt habe, trotz der Schrecken des Krieges zuvor. Sie waren ja auch Opfer. Und viele von ihnen seien gestorben.
Das Pensionat gab es nicht
Der alte Mann sagt auch, er habe von der Geschichte mit dem Pensionat gehört. Dieses Sanatorium habe es nicht gegeben.
Ähnliches berichtete auch die Frau in Bagdati. Den Friedhof habe es nicht an der Stelle gegeben, wo er jetzt sei. Er habe sich dort befunden, wo es nun die Sanatorien gebe. Als man diese bauen wollte und einen Grundstein dafür gelegt habe, habe man die Knochen gefunden. So habe man sie dann weiter nach unten gebracht.
Eine Geschichte war nicht, eine andere entsteht
Diese Geschichte stimmt also nicht. Ich werde sie im Roman nicht verwenden können. Aber ich weiß nun, was meine Personen machen werden.
Am Ende wird Jan vor diesem Friedhof stehen. Er wird die Hände vor den Mund schlagen, als sein Großvater ihm erzählt, dass er nach dem Ende der Sowjetunion Akten ausmisten durfte. Dass er dort auf Listen von Gefangenen gestoßen ist. Darauf hatte er den Namen des Bruders der Frau gefunden, die in Deutschland von ihm ein Kind bekommen hatte. Er wird erzählen, dass dieser Bruder beim Bau der Straße ums Leben gekommen war. Und dass er immer hierhin gefahren ist, wenn ihn die Erinnerung an diese Liebe übermannt hatte, um wenigstens diesem Menschen nahe sein zu können.
Artikel bei Einestages
Diese Geschichte ist in einer anderen Version auch bei Einestages vom Spiegel erschienen.